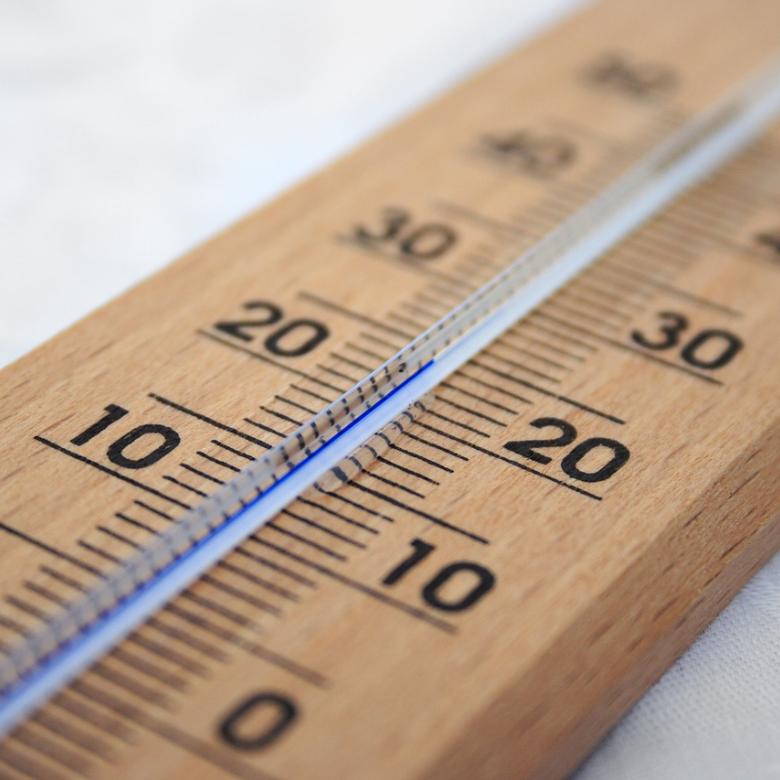Schädlingsbefall an kirchlicher Ausstattung ist nicht immer leicht zu erkennen. Viele Holzschädlinge sind besonders in Frühjahr und im Spätsommer in der Ausfugzeit der Insekten sichtbar. In diesem Zeitraum sollte besonders darauf geachtet werden, ob vermehrt Käfer in der Kirche gesichtet werden. Holzmehl an oder vor Ausstattungsobjekten oder kleine Bohr-/Ausfluglöcher deuten auf Holzschädlinge hin. Überall dort, wo Textilien gelagert werden, sollte auf Motten und Käfer geachtet werden. Das Auffinden von toten Insekten, Insektenkot oder Gespinsten im Schränken oder Schubladen kann auf einen Befall hindeuten.
Schimmelbildung tritt meistens zuerst unter den Kirchenbänken, hinter dem Altar und/oder an Ausstattungsobjekten auf, die nah an den Außenwänden platziert sind, und bleibt daher häufig unbemerkt. Auch an Objekten oder in Bereichen, in denen keine ausreichende Belüftung stattfindet, kommt es häufig zu Schimmelbildung. Hiervon sind etwa Skulpturen, die in Nischen stehen, oder auch Beichtstühle und mobile Ausstattung betroffen, die in Schränken aufbewahrt wird.