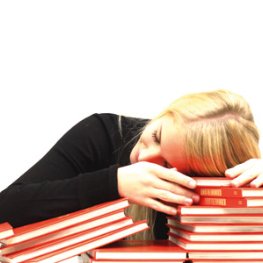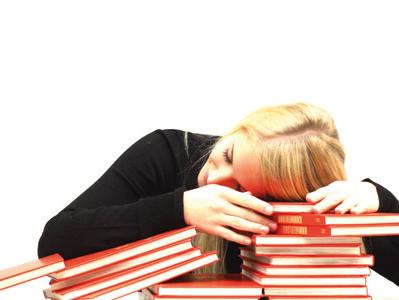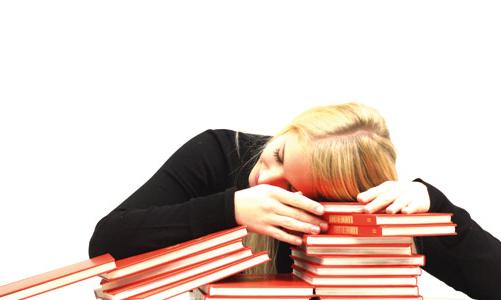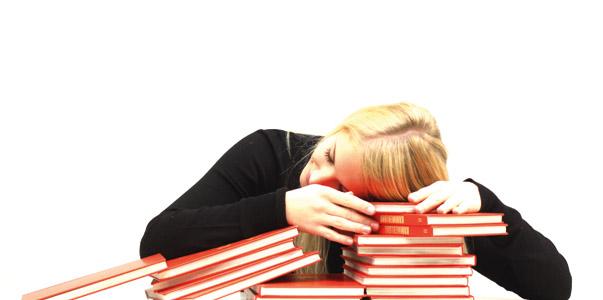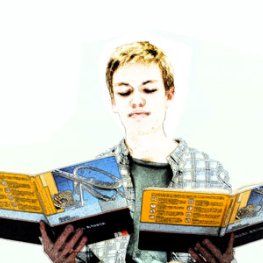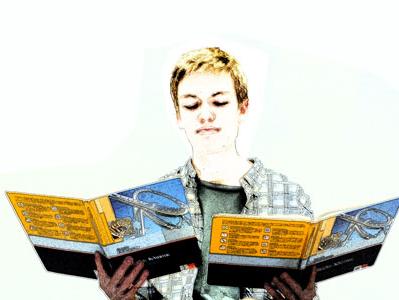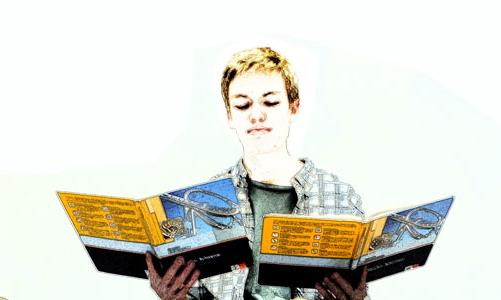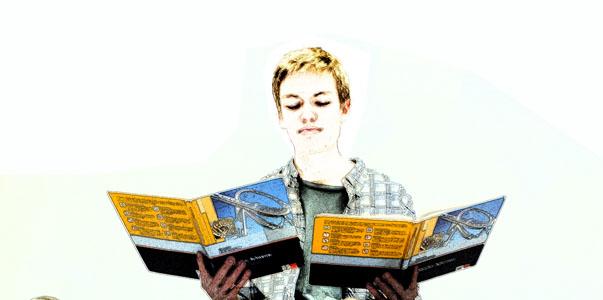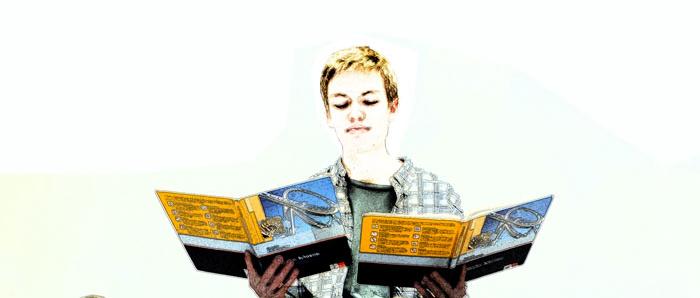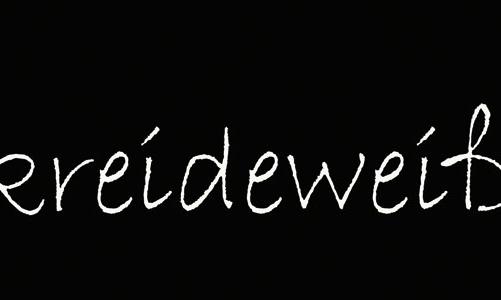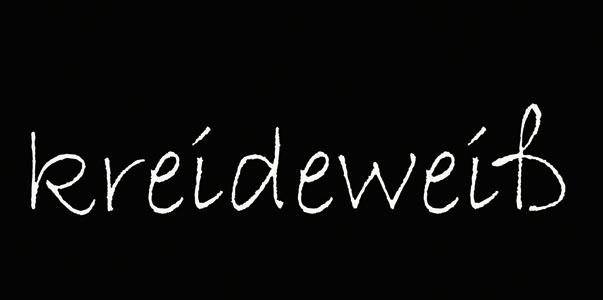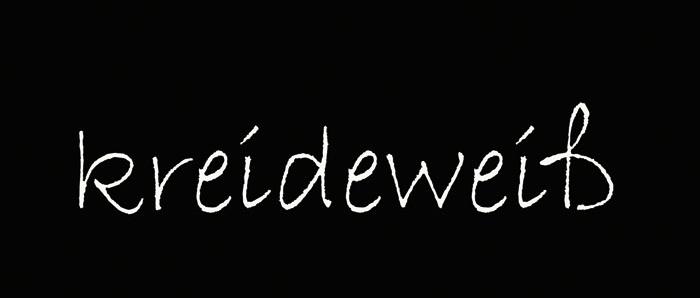Erfahrung, die von Mund zu Mund gehe, so Benjamin, sei die Quelle, aus der alle Erzähler geschöpft hätten. Es habe zwei archaische Stellvertreter des Erzählers gegeben : den sesshafte Ackerbauer und den Seemann. Sie , so Benjamin weiter, erzählten Wahrheiten: überlieferte und fremdartige Wahrheiten aus anderen Ländern.
Die volle Präsenz erhalte der Erzähler nur , wenn er beide Typen vergegenwärtigt. Wenn einer eine Reise tut, dann wisse er etwas zu erzählen. Beim einen seien es die Überlieferungen und beim anderen seien es die Berichte aus fernen Ländern.
Eine solche Durchdringung beider Erzählertypen habe insbesondere das Mittelalter mit seiner Handwerksverfassung begünstigt. Hier hätten eben der sesshafte Meister und die wandernden Burschen in der gleichen Stube zusammengesessen.
Wenn Bauern und Seelleute Altmeister des Erzählens gewesen seien, dann sei der Handwerksstand seine hohe Schule gewesen. Benjamin betont die Ausrichtung auf das praktische Interesse als einen charakteristischen Zug bei vielen geborenen Erzählern.
„Dieser Nutzen mag in der Moral, in einer praktischen Anweisung oder einer Lebensregel bestehen. Der Erzähler ist ein Mann, der dem Hörer Rat weiß“.
Nun klinge „Rat wissen“ heute altmodisch . Daran sei der Umstand schuld, dass Mitteilbarkeit der Erfahrung abnehme. Infolge wüssten wir uns und anderen keinen Rat.
Rat sei minder eine Antwort auf eine Frage als vielmehr ein Vorschlag. Ein Mensch öffne sich einem Rat nur soweit, als er seine Lage zu Wort kommen lasse.
Der der Erzählung immanente Rat muss auf das Gegenüber zugeschnitten sein, was in der kontextuellen Situation des Erzählers möglich ist. Es können kleinste synästhetische Wahrnehmungen, Blickkontakte oder auch nur das Timing der Erzählung sein. Der Erzähler ist ein guter Erzähler, Pädagoge oder Lehrer wenn er das Dispositiv bereitet, das dem Gegenüber ermöglicht, seine Lage zu Wort kommen zu lassen.
Rat , so Benjamin weiter, in den Stoff gelebten Lebens eingewebt sei Weisheit. Die Kunst des Erzählens neige sich aber ihrem Ende zu weil die epische Seite der Wahrheit, die Weisheit aussterbe.
Benjamin kennzeichnet diesen Prozess nicht als Verfallserscheinung der Moderne, vielmehr sei es eine Begleiterscheinung säkularer geschichtlicher Produktivkräfte, die die Erzählung ganz allmählich aus dem Bereich der lebendigen Rede entrückt habe.
Man sitze eben nicht mehr zusammen um zu erzählen; es würden keine Wahrheiten mehr im Gespräch weitergereicht. Die Fähigkeit, Ratschläge im verständigen Gespräch zu erteilen und in das Leben des Gegenüber einzuweben sterbe aus.
Mit dem Aufkommen des Romans zu Beginn der Neuzeit geht die Erzählung eine Vermählung mit der Technik ein und erfährt einen Strukturwandel. Der Roman ist auf das Buch angewiesen, wird in der Einsamkeit geschrieben und bedarf der Buchdruckerkunst.