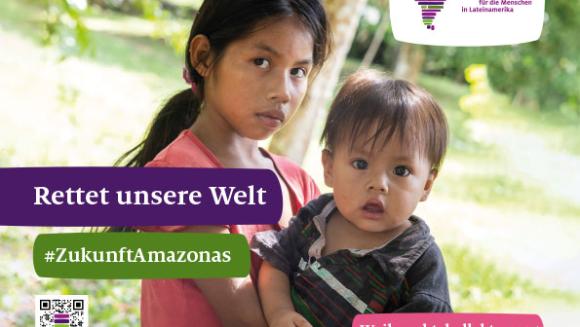Dem Verlust begegnen:Studientag Trauerpastoral 2025 im KSI Siegburg

Laura Mattausch hat mit 22 ihren Vater verloren. Die junge Frau weiß nicht, wohin mit ihrer Trauer, und stößt im Internet auf einen Trauerchat, der Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Bewältigung ihrer Verlusterfahrung helfen will. Inzwischen steht die heute 28-Jährige auf der anderen Seite und engagiert sich ehrenamtlich bei diesem Angebot des Hospizes Bedburg-Bergheim als sogenannte „Chatbegleiterin“. Projektleiterin ist Maria Riederer, Koordinatorin im Ambulanten Hospizdienst.
Trauerchat als Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene
Gemeinsam stellen beide Frauen ihre Arbeit in einem Workshop vor und berichten davon, wie solche Initiativen funktionieren. „Man kann kommen, aber auch wieder gehen und dabei ganz anonym bleiben, ohne jede Verpflichtung“, erklärt Mattausch. Für junge Leute sei gerade das Prinzip der Unverbindlichkeit wichtig. Die Kontaktaufnahme laufe ausschließlich schriftlich per Whatsapp ab. Die meisten benutzten Nicknames, also ein selbstgewähltes Pseudonym, unter dem sie sich ihre Trauer von der Seele schrieben und mit viel Empathie aufgefangen würden.
„Manchmal entstehen lange schöne ‚Gespräche’“, so die Chatbegleiterin, „oft aber ist es auch nur eine kurze Begegnung. Meist findet sie in der Akutphase statt, mitunter aber auch erst Jahre später. Jeder wählt selbst, wann er was preisgeben möchte und was ihm im Austausch mit anderen hilft.“
Die Themen der User, die im Chat auf eine Peergroup träfen – und darin liege die eigentliche Hilfestellung – seien ernst: abgrundtiefe Traurigkeit, Schlaflosigkeit, Schuldgefühle, Depressionen, auch Suizidgedanken. Da erzählt „Phoenix“ von dem an Corona verstorbenen Vater oder „Paulinchen“ davon, dass ihrer im Urlaub ertrunken sei und nun in der Familie eine schmerzliche Lücke hinterlassen habe.
Für den Ernstfall vorbereitet sein
Mit solchen schweren Verlusterfahrungen von Jugendlichen sei er zum Glück noch nicht konfrontiert worden, berichtet Christoph Kranz, ehrenamtlicher Bestattungsbeauftragter im Erzbistum. Trotzdem wolle er sich für den Fall der Fälle rüsten und Ideen sammeln, wie er dann angemessen darauf reagieren könne.
Auch Peter Jakob Hennen will sich für den Ernstfall „besser aufstellen“, wie er seine Motivation, hier mit dabei zu sein, begründet. Er war bei dem ersten Ausbildungskurs, dem Pilotprojekt in Sachen Bestattungsbeauftragung, mit dabei. Und Angelika Ockel, ehemals Schulleiterin an der Ursulinenrealschule in Köln und in der Ökumenischen Hospizbewegung Düsseldorf aktiv, berichtet, dass der Verlust eines Elternteils für Schüler eine Extremsituation darstelle, in die eine ganze Schule involviert sei. Sie habe schon öfter Jugendliche an den Trauerchat verwiesen, teilt sie den anderen mit, und lobt ausdrücklich, was ein Stab an Ehrenamtlern bei diesem digitalen Angebot leistet.
Dieser sei zweimal in der Woche offen, informiert Maria Riederer. „Jugendliche sind in ihrer ganzen Entwicklung Richtung Leben unterwegs und werden mit einem Mal auf diesem Weg ausgebremst. Mit dem Tod läuft dann alles in die Mitte der Familie zurück und damit konträr zu dem, was man in der Pubertät eigentlich erlebt“, beschreibt sie, wie sie junge Menschen mit Verlusterfahrung erlebt.
Mit Gleichaltrigen vernetzen
Sei die erste Anteilnahme in der Schule oder dem sozialen Umfeld vorbei, führe das nicht selten zu einer großen Einsamkeit und der Überzeugung: Niemand versteht mich. Von daher sei es enorm tröstlich, sich mit Gleichaltrigen, die dieselbe Trauer durchlebten, vernetzen zu können.
Der Trauerchat für Jugendliche ist nur eines der vielen Themen, die Eva-Maria Will, Referentin für Trauerpastoral und Bestattungskultur im Erzbischöflichen Generalvikariat, für die etwa 100 Interessierten an dieser Tagung fakultativ zusammengestellt hat.
Andere Gesprächsrunden beschäftigen sich mit der traumatischen Trauer von Migrantinnen und Migranten nach Heimatverlust und Flucht, mit dem Aufbau eines Trauercafés in der Gemeinde, wie es Engagementförderin Christiane Hartel, Inge Mody und Ellen Naue aus Ratingen vorstellen. Zu spirituellen Erinnerungsangeboten wie Gespräch, Gebet und monatlichen Spaziergängen regt Pastoralreferent Alexander Neuroth aus Neuss an.
Über Trauerarbeitkonzepte wie dem Einsatz der Transaktionsanalyse spricht Pfarrer Andreas Schönfeld aus Brühl, wobei er in seinem AK nochmals wesentliche Inhalte aus seinem zuvor gehaltenen Vortrag aufgreift. Und Cornelia Will, Anglistin und Germanistin aus Köln, lädt bei ihrem Workshop zu einem Literaturgespräch ein, bei dem sie den Bestseller „Bevor der Kaffee kalt wird“ des japanischen Autors Toshikazu Kawaguchi ins Zentrum stellt und sich mit dem Gedankenspiel einer Zeitreise und der fiktiven Wiederbegegnung mit dem Verstorbenen auseinandersetzt.
"Markt der Möglichkeiten" und reger Austausch
Auch beim „Markt der Möglichkeiten“, bei dem eine Klinikseelsorgerin, eine Kunsttherapeutin, ein Experte für Ehe-, Familien- und Lebensberatung, eine Referentin aus der Altenpastoral sowie ein Notfallseelsorger ihre Arbeit vorstellen, wird auf flankierende Unterstützungsangebot bei Trauer gesetzt, die das gesamte Spektrum an möglichen Methoden umreißen.
Veranstalterin Eva-Maria Will beobachtet seit Jahren ein „starkes Bedürfnis nach Austausch“ im Bereich der gemeindlichen Trauerpastoral, bei der immer auch der persönliche Glaube gefordert sei. Daher die Idee zu diesem Tag. Außerdem will sie einen Beitrag dazu leisten, „dass Gemeinden ihren diakonalen Auftrag auf diesem Gebiet wiederentdecken“.
Kernaufgabe der Kirche
Schließlich gehöre Trauernde zu trösten zu den Werken der Barmherzigkeit und sei daher eine Kernaufgabe der ganzen Kirche, so die Theologin, zumal der Bedarf an Begleitung und Seelsorge kontinuierlich wachse. „Deshalb müssen wir Trauernden verstärkt das Gespräch anbieten oder neue Formen der Begleitung wie Trauercafés etablieren, um die Trauerpastoral auch ein Stück weit neu aufzusetzen.“
Solche Studientage, die den Akteuren auch Fortbildung böten, würden dazu beitragen, Erfahrungen mit Sterben, Tod und Trost aus der Tabu-Ecke mitten ins Leben zu holen. „Es ist ein Ganzjahresthema und verdient nicht, in den November ausgelagert zu sein“, betont Will ausdrücklich. „Katastrophen wie in Graz oder auch Hürth, bei denen Menschen auf furchtbare Weise aus dem Leben gerissen werden, hinterlassen Fassungslosigkeit und werfen gleichzeitig die Frage auf: Wie gehen wir damit um?“
Wobei es neben solchen Extremfällen auch noch ganz andere Arten von Verlust gäbe: Wenn beispielsweise jemand seine Heimat verliere oder auch seinen Arbeitsplatz. „Trauer gehört zum Menschsein. Wie oft sind wir ihr im Alltag ausgeliefert und wissen nicht weiter.“ Nicht immer sei zwangsläufig der Tod eines Menschen der Auslöser für Trauer.
Ein Leben zweigeteilt
Trauer teile das Leben meist in ein „Davor“ und ein „Danach“, weiß Dr. Andrijana Glavas, Medizinerin und Caritaswissenschaftlerin an der Universität Freiburg, die als gebürtige Kroatin Anfang der 90er Jahre den Krieg in ihrem Heimatland miterlebt hat und bei ihren Forschungen immer wieder feststellen konnte, dass zum Beispiel bei der Traumabewältigung zurückkehrender Soldaten neben der Medizin auch spiritueller Trost zur Heilung beiträgt.
In ihrem Impulsreferat definiert sie Trauer als einen Anpassungsprozess an eine veränderte Lebenswirklichkeit, der eine ganze Bandbreite an Gefühlen – von Traurigkeit, Sehnsucht und Wut über Angst und Selbstvorwürfe bis hin zu emotionaler Taubheit und Apathie – freisetzen könne und auf der körperlichen Ebene Symptome von Erschöpfung aufweise.
Trotzdem stellt sie fest: „Trauer ist keine Krankheit, sondern ein elementares Geschehen und hat einen ganz individuellen Verlauf. Daher gibt es auch kein richtig und kein falsch.“ Vielmehr müsse sie in die eigene Identität integriert werden, damit man weiterleben könne. Nur zehn Prozent aller Trauernden bedürften bei einer Pathologisierung psychotherapeutischer oder spiritueller Begleitung.
Allerdings beschleunige anhaltende Trauer die biologische Alterung, beeinflusse die Epigenetik und sorge für eine transgenerationale Weitergabe von posttraumatischen Belastungsstörungen; ein Schwerpunkt ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Hilfreich, so führt Glavas aus, seien in Abgrenzung zu einer verlustorientierten Bewältigung hingegen eine wiederherstellungsorientierte, die die Entwicklung neuer Perspektiven und Sinnkonstruktionen im Alltag forciere.
"Trost ist eine Gabe des Geistes"
Dass Religiosität eine wichtige Ressource bei der Bewältigung von Trauer ist, stellt Pfarrer Andreas Schönfeld in seinem Vortrag dar. Der Seelsorger, der auch Transaktionsanalytiker, Supervisor und Heilpraktiker ist, benennt gleich eine ganze Liste an „Trostquellen als Ressource im Trauerprozess“ wie ein funktionierendes Beziehungsnetz, Autonomie, Kreativität, Werteerfahrung, Bildung und Kultur sowie den Glauben, religiöse Rituale und spirituelles Wissen.
Es könne in der Seelsorge bei der Begleitung trauernder Menschen helfen, zudem wichtige Erkenntnisse der wissenschaftlichen Trauerpsychologie wahrzunehmen. Wörtlich sagt der Theologe aus Brühl: „Trost ist eine Gabe des Geistes, ein unverfügbares Geschenk. Trost ist nicht herstellbar oder zu kaufen. Er stellt sich ein oder auch nicht.“ Jede Trostbedürftigkeit müsse unterschiedlich beantwortet werden. Echten Trost zu spenden – und eben nicht eine billige Vertröstung auf Später oder das Jenseits anzubieten – müsse für jeden Begleiter bedeuten, Vertrauen zu vermitteln, einen Anker zu geben, Sicherheit und Halt zu schaffen – wie ein Baum, der feste Wurzeln habe.
Gleichzeitig sei ein guter Trauerbegleiter immer auch konfrontativ und ermahne dazu, nicht im Schmerz zu verharren und – wenn diese Offenheit bestehe – eine spirituelle Dimension zu eröffnen, die die Sehnsucht nach irgendeiner Form des Weiterlebens zum Ausdruck bringe. Schönfelds konkrete Empfehlung: im inneren Dialog mit dem Verstorbenen zu bleiben und aufmerksam für verborgene Botschaften, die dieser Beziehung zugrunde liegen, zu sein.
Trauer in muslimischen Gemeinschaften
Über „Glaubens- und Jenseitsvorstellungen im Islam“ spricht schließlich Professor Thomas Lemmen. Der Kölner Theologe, Islamwissenschaftler und Studiengangleiter des Masterstudiengangs Interreligiöse Dialogkompetenz, der sich seit 20 Jahren mit muslimischen Bestattungen befasst, betont die Vielfalt dieser Religion. Wörtlich sagt er: „Es gibt keinen homo islamicus.“
Die Diversität von Menschen muslimischen Glaubens spiegele sich allein schon in der Tatsache, dass es Sunniten, Aleviten, Schiiten, Ahmadis und sonstige Zugehörige gebe, die mehrheitlich aus der Türkei, dem Mittleren und Nahen Osten sowie aus Nordafrika, aber inzwischen auch anderen Ländern weltweit stammten. Sie brächten jeweils ihre eigene Kultur im Umgang mit dem Tod und den Toten ein und hätten ihre individuellen Rituale, die angesichts ihrer Pflege allerdings eine Gemeinschaftsaufgabe sei.
So versammelten sich in einem Trauerhaus immer gleich viele Trauernde, um den Angehörigen Trost zu spenden und die Todesnachricht möglichst schnell zu verbreiten, aber auch um möglichst viele an den Trauerritualen wie der vorgeschriebenen Waschung oder der Ausrichtung des Toten gen Mekka zu beteiligen. Der Tod gehöre für die Muslime wie das Leben dazu, sagt Lemmen. Mit ihm verbinde sich die Vorstellung einer Auferstehung am Ende der Zeiten. Eine ganz typische Kondolenz aus dem Koran laute: Wir kommen von Gott und kehren zu ihm zurück.
Aktuelle Nachrichten aus dem Erzbistum Köln
Pressemitteilungen
Alle Pressemitteilungen des Erzbistums Köln finden Sie im Pressebereich.
Suche innerhalb der News
Service und Kontakt
Service und Kontakt
Pressekontakt
Geschäftszeiten
Pressekontakt
Geschäftszeiten
Mo-Do: 8.30 - 17 Uhr
Fr: 8.30 - 14 Uhr
Erzbistum Köln
Newsdesk