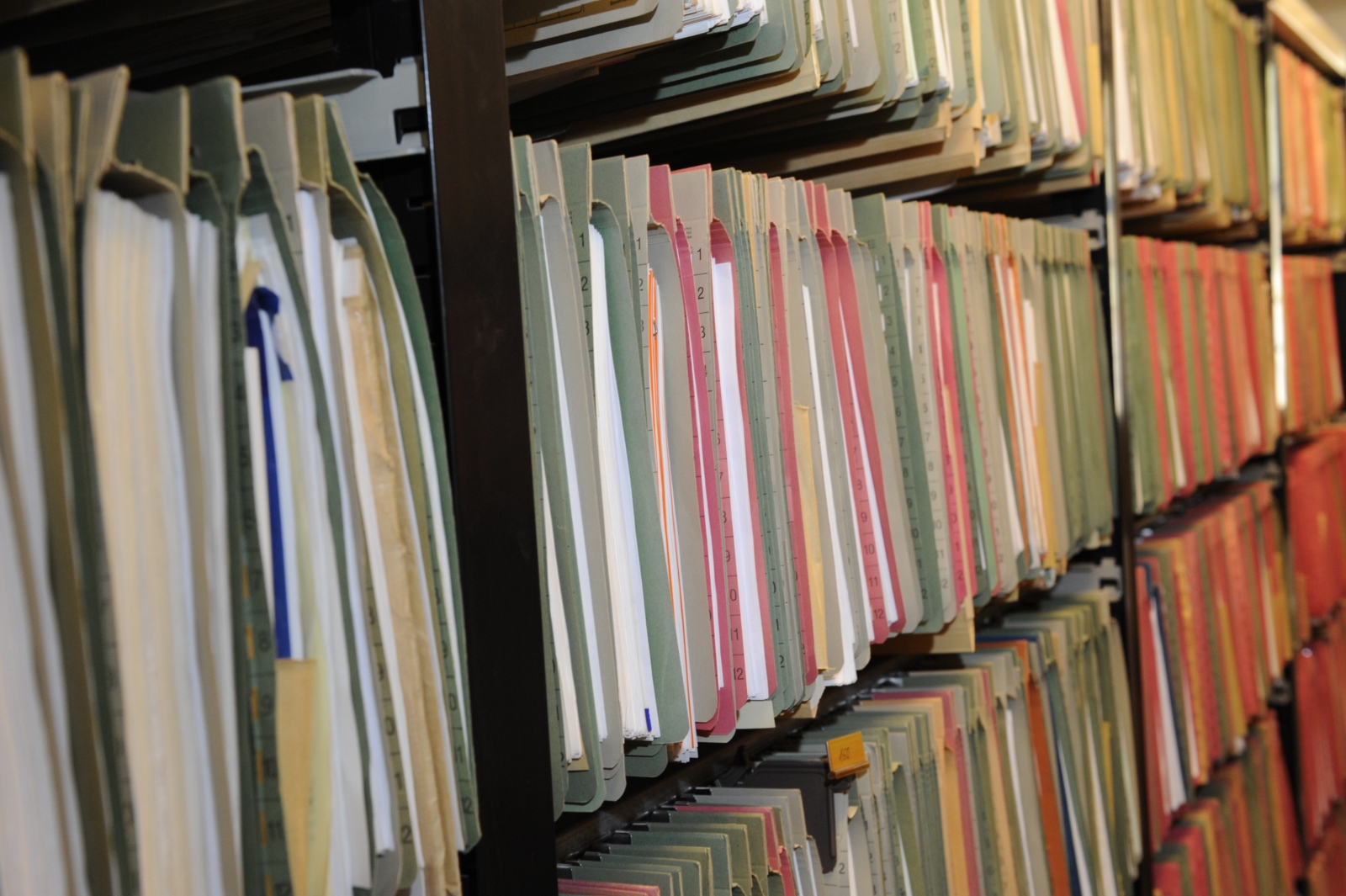Abläufe und Hintergründe:Selig- und Heiligsprechung: Heiligenverehrung in der katholischen Kirche
Datum:
4. September 2025
Die katholische Kirche kennt unzählige Heilige, die von den Gläubigen verehrt werden – und auch heute noch werden Heiligsprechungen vorgenommen. Im Heiligen Jahr 2025 kommen neue Heilige dazu. Was aber braucht es für eine Heiligsprechung?
Maria, Johannes der Täufer und Petrus zählen zu den bekanntesten Heiligen der Katholischen Kirche. Sie und unzählige weitere werden von katholischen Gläubigen als Heilige verehrt. Auch im Jahr 2025 stehen mehrere Heiligsprechungen an; unter anderem ist Carlo Acutis, der erste heilige Millennial, dazugekommen.
Bevor es zu einer Heiligsprechung kommt, wird jedoch ein umfangreiches Verfahren in Gang gesetzt.